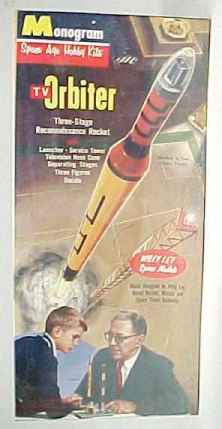| Homo
Magi - Teambeitrag Raumfahrt, Sex und Rituale Eine Buch-Rezension |
|
|||
|
Raumfahrt, Sex & Rituale.
Die okkulte Welt des Jack Parsons. Originaltitel: "Sex and Rockets" Verfasst von John Carter. Mit
einer Einführung von Robert Anton Wilson. Übersetzung: Silke Ecks. Lektorat: Frank Cebulla Hadit Verlag (2003), 292 Seiten,
24,95 Euro, ISBN 3-9808560-1-1 Parsons war von allem ein wenig
– Magier, Raketentechniker, Science Fiction Fan, Liberaler, Dichter,
Sex Maniac. Er war eine Kerze, die an beiden Enden brennt – schnell
und heftig, doch eines Tages verbrannte er. Zuerst eine Klarstellung: Dies ist ein wichtiges Buch, weil es Geschehnisse aufzeichnet, die in den Jahren um den 2. Weltkrieg herum passiert sind – nicht gerade die bestdokumentierteste Phase der Geschichte der Magie oder der Science Fiction. Und Parsons befand sich in einer Zeit, in der sich viel bewegt hat, in einem Nexus – er traf viele Menschen, die wiederum viele andere Menschen trafen, die alle berühmt oder zumindest berüchtigt wurden. Aber eben weil dieses Buch so wichtig ist, ist es notwendig, dass man auf die Fehler hinweist, die es enthält, aber auch die Stärken lobt, die es hat. Die Aufmachung des Buches ist
sehr gut: roter, fester Einband mit einer guten Grafik. Das Buch besitzt
einen Anhang mit sehr guten Fotos, die auch erstklassig beschriftet
sind. Die im englischen Original reproduzierten Artikel werden im Anhang
übersetzt, so dass Englischkenntnisse nicht zwingend notwendig sind.
Alleine schon vom Äußeren und der Aufmachung her ist dieses Buch eine
Pracht, die man sich gerne ins Regal stellt. Nur das „Literatur und
Quellenverzeichnis“ ist ärgerlich, da es leider nicht durchgängig in
der richtigen alphabetischen Reihenfolge ist. Wilsons Vorwort „Ein Wunder
lebte unter uns“ skizziert kurz Parsons Leben – wobei er natürlich
darauf hinweisen muss, dass Parsons Geburt am selben Tag eintrat, an dem
auch – laut dem Gründer der Zeugen Jehovas – die Apokalypse
beginnen würde. Wilson hat einen angenehmen Stil, der immer wieder
zwischen Ironie und Zen zu schwanken scheint. Das Vorwort Carters ist schon
verwirrender. Die einleitenden Sätze lauten: „»Wie soll ich
schreiben von dem Mysterium und dem Schrecken, dem Wunder, dem Mitleid
und dem Gleißen des siebenfachen Sterns, das Babalon ist?« Ich werde
von dem tragischen Leben ihres hingegebensten Jüngers und geliebten
Sohnes erzählen – ihr bekannt als Frater Belarion und der Welt der
Menschen als Jack Parsons.“[1] Das erste Kapitel namens „Die
frühen Jahre: 1914 – 1936“ schildert Parsons Kindheit und Jugend,
das Milieu, aus dem er stammt. Dazu kommen seine frühe Faszination mit
Raumschiffen, sein Interesse an Physik und Chemie. Parsons scheint von
zwei Energien getrieben: Der Suche nach dem Vater und der Suche nach den
anderen Räumen, die jenseits den Grenzen der Erde liegen. Die nächste Phase seines Lebens
(„Parsons am Caltech: 1936 – 1939“) schildert seine Arbeit als
Raketenpionier. Interessant ist, mit welchem Enthusiasmus, aber auch mit
welcher Blauäugigkeit (zumindest von unserer heutigen Sicht aus) die
Raketen-Experimente unternommen wurde. Raumfahrt war damals noch keine
ernstzunehmende wissenschaftliche Idee, sondern der Traum einiger
Spinner und Idealisten, die erst einmal versuchen mussten, mit Raketen
die oberen Schichten der Atmosphäre zu erreichen. Vom Weltraum war nur
zu träumen ... Um die Hintergründe seiner magischen Arbeit zu schildern, wird in Kapitel drei „Eine kurze Geschichte des OTO“ geboten.
„Parsons Doppelleben: 1940 –
1942“ schildert sowohl seine Arbeit an den Raketen (an dieser Stelle
findet sich ein toller Artikel aus „Popular Mechanics“ über die
Arbeit seiner Gruppe), als auch sein Interesse an Magie und Science
Fiction. Parsons trat in die Science Fiction-Ortsgruppe von Forrest J.
Ackermann ein.[2]
Dazu kommen Bekanntschaften mit Ray Bradbury, Robert A. Heinlein,
Anthony Boucher (der Parsons mit dem Roman „Rocket to the Morgue“
ein Denkmal gesetzt haben soll!) u.a. Die Jahre bis zum Ende des
Krieges schildert das Kapitel „Rückkehr in die South Orange Grove
Avenue: 1942 – 1945“. Parsons verstrickt sich tiefer in die Magie,
heiratet, seine Frau bekommt vom Logenmeister ein Kind, man lebt in
eigenartigen Lebensgemeinschaften und praktiziert Magie. 1945 stößt
ein nicht unbekannter Mensch zu der Gruppe: L. Ron Hubbard. Parsons war
inzwischen mit der jüngeren Schwester seiner Frau zusammen, diese war
aber auch Hubbards Geliebte (und verließ Parsons später wegen ihm). Crowley und Parsons verstanden
sich, obwohl sie sich nur durch Briefe kannten, harmonierten
miteinander. Das Kapitel „Eine Einführung in die henochische Magie“
arbeitet schön die Parallelen zwischen den Paaren Crowley-Parsons und
Dee-Kelley heraus. Wie auch schon der Darstellung
der Geschichte des OTO ist Carter in der Lage, komplizierte Zusammenhänge
verständlich zu beschreiben. Anderenfalls wäre ich auch in Kapitel 7
und 8 (über die Arbeit an der Beschwörung von Babalon) völlig
verloren gewesen. In dieser Beschreibung fällt die immense Menge von
Crowley-Zirkelschlüssen auf. (Fast) alle Dinge in der Magie Parsons‘
werden durch Crowley-Zitate belegt oder erklärt. Und wenn bei der
Mitschrift mal was nicht stimmt, dann liegt es nicht an der Magie:
„Dies könnte darauf hinweisen, dass die Aufzeichnungen in dieser
Hinsicht entstellt ist.“[3] Dies ist mir eine etwas zu
einfache Begründung. Die Beschreibung des Rituals ist
lang, fast zu lang, aber man kann so die Schritte nachvollziehen, die
Parsons gegangen ist, um sein Ziel zu erreichen: „Der Zweck der
Parsons’schen [sic] Babalon-Arbeit scheint die Geburt eines Kindes
gewesen zu sein – des Mondkindes – in das Babalon sich hineinverkörpern
sollte.“[4] „Parsons’ letzte Jahre: 1946
– 1952“ schildert das neunte Kapitel. Es kommt zum Bruch zwischen
Parsons und Hubbard, der mit Parsons Geld und Frau abhaut. Lapidar heißt
es dann weiter: „Hubbards Karriere mit Scientology ist in
verschiedenen Versionen gut belegt.“[5]
Hier wären ein paar Sätze mehr informativ gewesen. Parsons scheint mehr und mehr
die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Er gerät wegen geheimer
Papiere in Sicherheitsüberprüfungen, seine magische Arbeit ufert immer
mehr aus. Es kam wie es kommen musste: Alles strebt zur Katharsis und am
Ende stirbt Parsons im eigenen Haus an einer Explosion, die er wohl
selbst unvorsichtigerweise hervorgerufen hat (Kapitel zehn: „Tod und
Jenseits“). Er überlebt die Explosion, stirbt aber wenig später
(sein körperlicher Zustand war auch so, dass er sich wohl nicht gewünscht
hätte, noch weiter zu leben ...). Parsons Arbeit mit Babalon
hinterlässt Spuren. So gibt es mehr als einen, der Babalon mit dem
Auftreten der UFOs in Verbindung bringt. Und immer noch ist Parsons –
vielleicht gerade deswegen, weil er so früh und dramatisch gestorben
ist – ein Mythos, ein Rätsel, ein Enigma. Lustig zu lesen ist, wie
Hubbards Scientology später versuchte, auf die Schilderung der
Ereignisse einzuwirken. „Überzeugend“ beginnt der zitierte
Scientology-Text so: „Hubbard zerstörte schwarze Magie in Amerika
(...).“[6] Genau so habe ich mir das
vorgestellt. Hubbard ist (wie immer) an nichts schuld, arbeitet für die
Guten und hat alles allein gerettet. Das Buch endet mit einem
wunderschönen Satz: „John Parsons, selbsterklärter Antichrist, mag
nicht das Ende der Welt herbeigeführt haben, aber durch seine Beiträge
zu Wissenschaft und Forschung spielte er eine Rolle dabei, den Anfang
des Universums hervorzubringen.“[7] Noch einmal: Dies ist ein gutes
Buch und ich hatte viel Spaß daran, es zu lesen. Alle drei im
(deutschen) Titel genannten Felder werden abgearbeitet: Raumfahrt, Sex
und Rituale. Und es werden Zusammenhänge beleuchtet, die im Science
Fiction-Fandom zwar bekannt sind (wenn man sich mit dem Thema wirklich
beschäftigt), aber nicht diskutiert werden (wohl auch, weil kein Mensch
weiß, wo man darüber Informationen erhält). Trotzdem muss ich einiges an
Kritik an der Ausgabe loswerden. Zuerst sind da die Übersetzungsfehler.
Einige Stellen sind so übersetzt, dass man nicht versteht, was im
Original stehen könnte. Das sieht dann so aus: „Zu verschiedenen
Zeitpunkten während des Lebens dieser Männer waren Österreich und
Deutschland wiederholt ein Teil Preußens, damals eine bedeutende
westliche Großmacht.“[8]
Die beiden Männer waren Kellner (geb. 1851) und Reuß (geb. 1855).
Jetzt darf jeder seinen Geschichtsatlas rausholen und schauen, wann
Deutschland (oder Österreich) mal ein Teil Preußens war ... oder man
darf sich überlegen, was der Satz im Original heißen möge. In anderen Fällen bleiben im
Deutschen Sätze stehen, die einfach nur skurril klingen, wie „Die
JATOs waren ein Erfolg, und Parsons war der Gelobte.“[9] und „Der Kriegseintritt
stand bevor (Pearl Harbour lag nur einen Monat voraus) (...).“[10] Oder: „Im Versuch, sich die
Sache schönzufärben (...).“ Für diesen Halbsatz gibt es eine eigene
Fußnote: „wörtlich: (süße) Limonade aus (sauren) Zitronen zu
machen [A.d.Ü.]“[11]
Aha. Und auch der Artikel „L.A.’s Lust Cult“ wird in der Fußnote
brav mit „L.A.’s Lust-Kult [A.d.Ü.]“ übersetzt.[12]
Soweit hätte mein Englisch noch gereicht. Schön sind Sätze wie: „Mit
einigen Motorradfahrern zerstörte sie 1955 (...) den schwarzen Kasten
(...).“[13]
Waren die Motorradfahrer vielleicht im Original Biker und damit
Motorradrocker? Klingt doch gleich bedrohlicher. Der Buchtitel „Thread
of the Silk Worm“ wird in der Fußnote als „Der Faden der
Seidenraupe [A.d.Ü.]“ korrekt wiedergegeben, nur das Wortspiel Threat/Thread
bleibt unerkannt.[14] Angaben wie „Geschoepfe der
Finsternis“ in der Literaturliste sind einfach nur ärgerlich. Ein zweites Feld der Kritik bietet der mangelnde Einblick John Carters und aller anderen, die dieses Buch bearbeitet haben, in die Szene der amerikanischen Science Fiction-Fans. Parsons bewegte sich eindeutig in dieser Szene, entsprechende Begegnungen werden im Buch häufig genug erwähnt. Die (wenigen) Kommentare von Science Fiction-Autoren über Parsons hat Carter aber ignoriert.[15] Wahrscheinlich waren sie ihm einfach nicht bekannt.
Bestimmte Dinge sind falsch übersetzt,
sind in anderer Form im Deutschen üblich. So glaube ich nicht, dass der
vulkanische Gruß aus „Raumschiff Enterprise“ auf deutsch „Lebe
lang und gedeihe“ heißt – und „Dungeons & Dragons“ auf der
selben Seite wird auch nicht übersetzt.[16]
Dafür werden aber Zeitschriftentitel brav in Fußnoten übersetzt,
dabei ist es doch üblich, die im Original stehen zu lassen. So wird „Amazing
Stories“ in der Anmerkung des Übersetzers zu „Erstaunliche
Geschichten“.[17]
Danke. Viele Hinweise sind auch verschenkt, weil sie Übersetzerin und Lektor nicht erkannt haben. Mein Liebling ist folgender Satz: „John Parsons‘ FBI-Akten verweisen auf seinen Vater als Hauptmann (»Captain Marvel«) (...).“[18] Wow! Captain Marvel! Der erste amerikanische Comic-Held, der eine Synthese zwischen Magie und Superman versucht hat. Von den Fähigkeiten her eine klare Kopie der Superman-Figur, von der Begründung der Fähigkeiten her jedoch ein kleiner Junge, der sich durch die Anrufung des Zaubers Shazam (so auch der andere Name von Captain Marvel) nach einem mystischen Blitz in den Superhelden Shazam verwandelt. Und er erhält seine Fähigkeiten auf magischem Wege: S für Salomons Weisheit, H für die Stärke Herkules’, A für die Ausdauer Atlas’, Z für Zeus’ Kraft, A für Achilles’ Mut und das M für Merkurs Geschwindigkeit.[19]
Und dann der nicht-erkannte
Beanie: „Smith war ein Caltech-Student wie Malina und wurde als
Exzentriker betrachtet, da er ständig einen Tropenhelm trug, den er verändert
hatte, indem er einen kleinen Ventilator auf der Spitze anbrachte.“[20]
Hey, das ist DAS Markenzeichen von eigenartigen Science Fiction-Fans in
den USA! Der Hinweis fällt einem sofort auf, wenn man was vom Thema
versteht.[21] „The Visual Encyclopedia of
Science Fiction“ wird ohne Autoren zitiert.[22]
Der Herausgeber ist Brian Ash (London, 1977). Schön sind auch Carters üppige
Kenntnisse der phantastischen Literatur: „Bezüglich des Titels, auf
den sich Parsons von Smith taufen ließ: Belarion ist eine andere
Schreibweise (...) für »Belial« (...). Belarion wird von christlichen
Schreibern oft mit dem Tier in der Offenbarung gleichgesetzt (...). Eher
als dass er [Parsons] seinem Mentor nacheiferte, könnte freilich
Parsons diesen Beinamen aus einem Fantasyroman entnommen haben, in dem
es eine Figur mit diesem Namen gab.“[23]
Welcher Fantasyroman ist gemeint? Was macht diese Figur aus? „Helens gewählter Name,
Grimaud, ist ein französischer Name, der sich auf eine Gestalt eines
Romans von Lord Bulwer-Lytton beziehen könnte, die als ein magischer
Diener agierte. Bulwer-Lytton ist vielleicht dadurch am bekanntesten,
dass er einen Roman mit den Worten »Es war eine dunkle und stürmische
Nacht« begann.“[24]
Fairerweise sollte man Bulwer-Lyttons „Zanoni“ (1842) und „A
Strange Story“ (1861) erwähnen. Im „Lexikon der phantastischen
Literatur“ von Rein A. Zondergeld heißt es über ihn: „1859
erschien eine der berühmtesten Gespensterhaus-Erzählungen, die je
geschrieben wurden: »The Haunted and the Haunters.«“[25] Und die dritte Quelle für
Kritik sind die „magischen Kinkerlitzchen“, die Carter einstreut.
„Es scheint mehr als bloßer Zufall, dass die einzige Loge des OTO
sich in nur wenigen Meilen Entfernung von Parsons‘ Zuhause befand.“[26] Und was sagt uns das
jetzt? Die dazugehörige Fußnote „tatsächlich die einzige praktisch
arbeitende Loge des Ordens zu dieser Zeit [A.d.Ü.]“[27]
ist durch nichts belegt. Sieht aber beeindruckend aus, wenn man so etwas
mal behauptet. „Der Dolch ist eine der vier magischen Standardwaffen, die von einem Magier benutzt werden. Die anderen drei sind das Pentakel (oder die Scheibe), der Kelch und der Stab.“[28] Mit dem Tarot haben diese vier Dinge nichts zu tun, oder?
Einen Nachzügler noch: Die
Recherche. Über Raumfahrtpionier Willi Ley heißt es in der Fußnote
Carters: „Seine Bücher sind relativ leicht in Antiquariaten zu
finden. [in den USA wohlgemerkt, A. d. Ü.]“[29]
Ohne lange zu recherchieren fand ich „Start in den Weltraum“ (von
Braun/Ley) über zwanzig Mal bei www.zvab.de. Auch von seinen populärwissenschaftlichen
Titeln sind dort mindestens vier im Angebot – Recherchezeit ca. zwei
Minuten. Soviel Zeit muss man investieren, wenn man ein Buch lektorieren
will. Fazit: Ein wichtiges Buch, doch
leider an vielen Stellen schlampig bearbeitet. Hermann
Ritter, Juli 2004 Die Reaktion des Verlages ist wiedergegeben im Text "Parson zum zweiten" [1] S. 1 [2] Dankenswerterweise bin ich damit nur zwei Sprünge von Parson entfernt, was Bekanntschaften betrifft, weil ich kenne Forrest J. Ackermann. Hunderttausend andere aber auch. [3] S. 146 [4] S. 175 [5]
S. 180 [6]
S. 219 [7] S.227 [8]
S. 45 [9]
S. 77 [10]
S. 83 [11]
S 187 [12]
S. 213 [13]
S. 217 [14]
S. 222 [15] Am ausführlichsten L. Sprague de Camp in „Time and Chance“ (Hampton Falls, 1996), S. 212 f. [16]
S. XIV [17] S. 8 [18] S. 6 [19] Nur ein Verweis sei erlaubt: http://members.ozemail.com.au/~scunge/shazam/ [20] S. 18 [21] Wer mir nicht glauben mag: http://www.webdevelopersjournal.com/hubs/prophead_explanation.html [22]
S. 257 [23]
S. 185 f. [24] S. 67 [25] ebenda, S. 54 [26] S. 41 [27] ebenda [28] S. 139 [29] S. 10
|
Reaktion des Verlages siehe "Parson zum zweiten" Weitere
Teambeiträge: |
|||